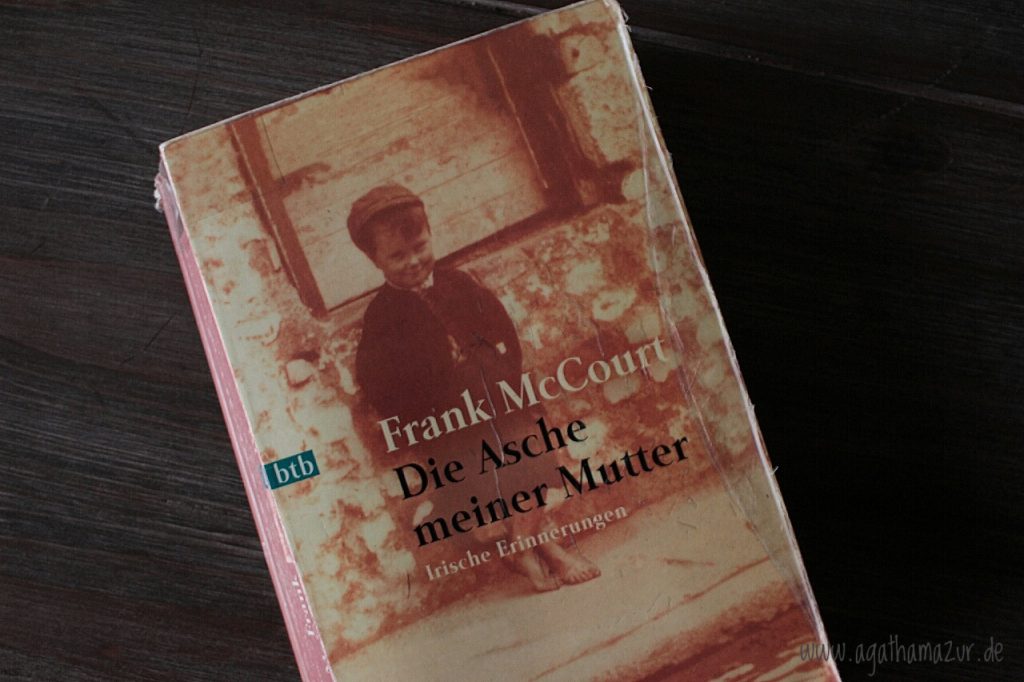Leverkusen ist vergangenes Jahr von Krisen nicht verschont geblieben: Zuerst das Hochwasser, dann die Explosion im Chempark. Über Journalismus in Katastrophenzeiten habe ich am Gewerkschaftstag des Deutschen Journalistenverbands NRW im November in Dortmund diskutiert.
In Katastrophen- und Krisenzeiten läuft Lokaljournalismus zu seiner Höchstform auf: Wer sonst könnte in diesen Situationen die Menschen vor Ort besser, schneller und umfassender informieren? Auf dem DJV-Journalisten-Tag habe ich gemeinsam mit Stefan Brandenburg, Leiter des Newsrooms vom WDR, und dem freien Journalisten Kay Bandermann darüber debattiert, wie man trotz Ausnahmesituationen – in der sich schließlich auch die Redaktionen befinden – fundierte und vor allem schnelle Berichterstattung auf die Beine stellen kann.

Es ging beispielsweise um die Frage, wie man Aktualität und Hintergrundinformationen gewichtet. Ich behaupte: In den ersten 24 bis 36 Stunden einer Katastrophe will kaum ein Leser oder eine Leserin etwas zu den Hintergründen wissen: Es zählt zuallererst die aktuelle Entwicklung.
Richtige Fragen müssen gestellt und beantwortet werden
Was passiert gerade wo, welcher Einsatz läuft, welche Straße ist überflutet, bin ich gefährdet durch die Rauchwolke? Erst mit einiger Verzögerung erwacht das Interesse der Bevölkerung an Hintergründen, Analysen und Fragen nach der Vorgeschichte oder möglichen Verfehlungen – dann aber muss der Lokaljournalismus diese Fragen stellen und Antworten liefern.
Und auch dranbleiben. Es ist durchaus eine Gratwanderung: Wie berichtet man in den Wochen, Monaten oder sogar Jahren nach einer Katastrophe mit welcher Intensität oder Frequenz – schließlich dreht sich die Welt weiter und die nächste Krise steht schon vor der Tür. Das Wort „Chronistenpflicht“ mag ich nicht, man sollte schließlich keine Berichterstattung um ihrer selbst willen machen. Das Interesse unserer Leserschaft muss eine der wichtigsten Prämissen bleiben. Und dennoch bin ich der Meinung, dass man solch einschneidenden Ereignisse möglichst langfristig und intensiv begleiten sollte: Um der Leserschaft das ganze Bild zu vermitteln und auch um ihr zu zeigen, dass wir JournalistInnen an wichtigen Themen dranbleiben und nicht nur „die nächste Sau durchs Dorf treiben“, wie der Vorwurf manchmal lautet.
Rege Nachfragen aus dem Publikum haben uns SpeakerInnen gezeigt, dass das ein wichtiges Thema innerhalb der Branche ist und es kein einheitliches Konzept gibt. Jede Katastrophe ist eben einzigartig und man muss individuell auf sie reagieren. Ich befürchte, wir werden in Zukunft noch genug Gelegenheiten haben, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen.
Mehr über den Journalistentag 2022 erfahrt ihr hier.
Header-Bild: Kay Bandermann (l.), Agatha Mazur und Stefan Brandenburg diskutieren in Dortmund (Bildcredit: Alexander Schneider)